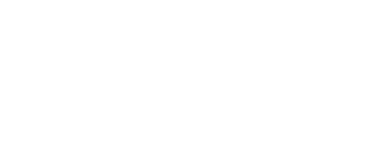Internationale Tagung zum Thema „Sprache, Literatur, Kultur und Nachhaltigkeit“ an unserer Universität durchgeführt
Die internationale Tagung mit dem Titel „Sprache, Literatur, Kultur und Nachhaltigkeit. Perspektiven aus DaF/DaZ, Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften“, die vom 9. bis 10. Oktober 2025 von der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften und der Hochschule für Fremdsprachen unserer Universität unter der Schirmherrschaft der Türkisch-Deutschen Universität veranstaltet wurde, fand mit einer intensiven wissenschaftlichen Beteiligung in den Sektionen Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft sowie Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache statt.
In den Eröffnungsreden betonte die Vizepräsidentin unserer Universität und Dekanin der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften, Prof. Dr. Aysel Uzuntaş, dass das Zusammentreffen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen auf internationaler Ebene rund um ein gemeinsames Thema unterschiedliche Perspektiven ermögliche, den wissenschaftlichen Austausch und die interkulturelle Kommunikation fördere. Sie hob hervor, dass Nachhaltigkeit neben ihren ökologischen Aspekten auch in ihren ökonomischen, sozialen, kulturellen und linguistischen Dimensionen betrachtet werden müsse.
Der Vizepräsident der Bakuer Slawischen Universität, Prof. Dr. Fikret Cihangirov, betonte, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein ökologisches, sondern ebenso ein kulturelles und gesellschaftliches Thema sei, und hob hervor, dass Kooperationen zwischen Universitäten die wissenschaftliche und internationale Interaktion stärken.
Die Direktorin der Hochschule für Fremdsprachen unserer Universität, Prof. Dr. Leyla Coşan, unterstrich die Bedeutung eines interdisziplinären Ansatzes im Umgang mit Nachhaltigkeit und erklärte, dass die Verbindung von Umwelt, Sprache, Kultur und Literatur aus einer gemeinsamen Perspektive einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leiste. Nach den Eröffnungsreden folgten die Hauptvorträge.
Die Hauptvorträge der Tagung begannen mit dem Beitrag von Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan zum Thema „Visuelle Mehrsprachigkeit als Vehikel der Beheimatung“, in dem visuelle Mehrsprachigkeit als Instrument des Zugehörigkeitsgefühls im Kontext von Migration behandelt wurde, und wurden mit dem Vortrag von Prof. Dr. Ernst Struck „Die Konstruktion einer Kultur der Nachhaltigkeit“ fortgesetzt, in dem die Entstehung und Entwicklung einer Nachhaltigkeitskultur thematisiert wurde.
Am ersten Tag der Tagung wurden in den Sektionen Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft und Sprachwissenschaft verschiedene Beiträge zum Thema Nachhaltigkeit präsentiert. Das Symposium bot den Teilnehmenden die Möglichkeit, das Konzept der Nachhaltigkeit in den Bereichen Sprache, Literatur und Kultur in einem interdisziplinären Rahmen zu diskutieren und aktuelle theoretische Ansätze sowie praktische Anwendungen zu reflektieren. Ziel der Veranstaltung war es, Nachhaltigkeit nicht nur in ihrer ökologischen, sondern auch in ihrer kulturellen, sprachlichen und gesellschaftlichen Dimension sichtbar zu machen.
In den Sektionen der Literatur- und Kulturwissenschaft wurden die Bedeutung des kritischen Denkens für die Entwicklung eines Nachhaltigkeitsbewusstseins, der Beitrag poetischer Denkweisen zur Entstehung einer nachhaltigen Sprachkultur sowie die Auswirkungen gesellschaftlicher Transformationsprozesse auf kulturelle Produktionen behandelt. Die Teilnehmenden diskutierten kulturelle Praktiken, die soziale Nachhaltigkeit stärken, die Neuinterpretation von Verantwortung und Gleichheit in Krisenzeiten sowie verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit in literarischen Darstellungsformen. Zudem wurden Zukunftsnarrative der zeitgenössischen Literatur, die Transformation mythologischer Figuren in Umweltkontexten sowie die Neukonstruktion kulturellen Gedächtnisses und des Zeitverständnisses im Rahmen von Nachhaltigkeit untersucht. In den sprachwissenschaftlichen Sektionen wurden sprachsensibler Unterricht, nachhaltige Lernstrategien anhand migrationsbezogener Filmszenen sowie die Vermittlung des Nachhaltigkeitsdiskurses in wissenschaftlichen Texten behandelt. Durch diese Beiträge wurden inklusive Philologie, interkulturelle Sensibilität und Prinzipien der Nachhaltigkeit in der Sprachbildung hervorgehoben.
Die Hauptvorträge des zweiten Tages begannen mit dem Beitrag von Prof. Dr. Carola Surkamp „Awareness, Aushandlungen und Ambiguitätstoleranz – Bildung für nachhaltige Entwicklung durch sprachliche, kulturelle und literarische Bildung“, in dem Bewusstseinsbildung, Aushandlungsprozesse und Ambiguitätstoleranz im Zusammenhang mit Bildung für nachhaltige Entwicklung thematisiert wurden. Anschließend folgte Dr. Zuzana Münch-Manková mit ihrem Vortrag „Nachhaltigkeit lehren lernen: Das Weltklimaspiel als Zugang zu BNE-Kompetenzen im DaF-Kontext“, in dem das Weltklimaspiel als Instrument zur Förderung nachhaltiger Bildungskompetenzen im Bereich Deutsch als Fremdsprache vorgestellt wurde.
In den Sitzungen des zweiten Tages wurden die Prinzipien der Nachhaltigkeit im Bereich Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache eingehend behandelt. Es wurde hervorgehoben, dass Sprache im Lernprozess nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein Träger gesellschaftlicher Transformation ist. Nachhaltigkeit in der Bildung wurde als ein kritischer und partizipativer Lernprozess definiert, bei dem Lehramtsstudierende eine transformative Rolle in der Vermittlung von Sprache, Kultur und Werten übernehmen sollen.
Ein weiterer Diskussionsschwerpunkt lag auf der Vermittlung nachhaltigkeitsorientierter Kompetenzen in der Lehrerbildung. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betonten die Bedeutung einer systematischen Integration von Nachhaltigkeitsthemen in die Curricula der pädagogischen Fakultäten und hoben die Verantwortung der Lehrkräfte hervor, Werte wie Gleichheit und Partizipation in den Unterricht zu integrieren. Die Diskussionen erfolgten insbesondere im Rahmen von Konzepten wie sprachsensibler Unterricht, empathisches Lernen und kritisches Bewusstsein.
Am zweiten Tag wurde auch das Potenzial der Digitalisierung in nachhaltigen Bildungsprozessen umfassend behandelt. Anhand von Beispielen wurde erläutert, wie virtuelle Lernumgebungen und digitale Spiele genutzt werden können, um Nachhaltigkeitsbewusstsein zu fördern sowie globale Zusammenarbeit und interkulturellen Dialog zwischen Studierenden zu stärken. Modelle wie Globales Lernen, Virtual Exchange und Online-Kooperation wurden als Instrumente bewertet, die sowohl digitale als auch kulturelle Kompetenzen der Lernenden fördern.
In den Sitzungen zur kulturellen Nachhaltigkeit wurden die transformatorische Kraft der Sprache in kulturellen Repräsentationen sowie ihre Beziehung zu Identität und Zugehörigkeit diskutiert. Nachhaltige kulturelle Entwicklung wurde nicht nur als Bewahrung der Vergangenheit, sondern auch als Förderung von Vielfalt, Mehrsprachigkeit und interkulturellem Dialog verstanden. Die Teilnehmenden betonten im Rahmen interkultureller Ansätze, dass Sprache ein starkes Mittel der Vermittlung sei und Nachhaltigkeit daher auf der Grundlage von Gleichheit und Respekt gedacht werden müsse.
Im Symposium wurde außerdem diskutiert, wie sprachliche Kreativität und literarische Produktion mit dem Bewusstsein für Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht werden können, insbesondere anhand neuer Lehrmethoden. Die Teilnehmenden stellten fest, dass die ästhetische Dimension der Sprache das Bewusstsein, die Empathie und das kritische Denken der Individuen fördere und somit die Sprachbildung ein wesentliches Instrument für nachhaltige kulturelle Transformation darstellt.
Die Abschlussbewertung des Symposiums wurde von Prof. Dr. Aysel Uzuntaş und Prof. Dr. Leyla Coşan vorgenommen.
Im interdisziplinär ausgerichteten Symposium wurde das Thema Nachhaltigkeit in einem ganzheitlichen Ansatz entlang der Achsen Sprache, Sprachunterricht, Kultur, Literatur und gesellschaftliche Verantwortung behandelt; es entstand ein Raum für internationalen Ideenaustausch und Erfahrungsteilung unter den Teilnehmenden. Unterstützt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und mit der Beteiligung der Universitäten Bielefeld und Heidelberg, leistete das Symposium einen Beitrag zu Nachhaltigkeitsdiskussionen nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus humaner, kultureller und ethischer Perspektive.